Computer sind ja integraler Bestandteil heutiger Fotografie. Also, jedenfalls professioneller, digitaler Fotografie. Deshalb nehme ich mir mal die Freiheit, meine persönliche Geschichte vom Wechsel zwischen einem PC und einem MAC und einem PC zu erzählen.
Vorweg: Ich bin durchaus kein “FANBOY”. Ehrlich gesagt, ist mir relativ wurscht, was das für ein Computer ist, auf dem ich arbeite, SOLANGE ER FUNKTIONIERT. Ja, die MACs sind einfach super schick. Das spricht mich tatsächlich an. Auch in der Windows-Welt gibt es schöne Rechner. Vor allem aber sind die PC’s ja um Längen besser in der Anschlussperipherie ausgestattet. Wie dem auch sei, was ich an dieser Stelle nur sagen will: Das hier wird kein einseitiger Bashing-Artikel. Denn beide haben so ihre Vorteile und Heimtücken. Ich wollte hier einfach nur mal loswerden, was mich gefreut, und vor allem was mich wahnsinnig geärgert hat. Und da bekommen durchaus beide Seiten ihr Fett weg… also kein einseitiges Bashing, sondern ein zweiseitiges…. 😉
Und weil das nicht in zwei Sätzen erledigt ist, wird das hier ein Zweiteiler.
Also, auf geht’s:
Hier erzähle ich Dir erstmal die Geschichte, warum ich eigentlich 2010 in den preislich gesehen sehr sauren Apfel biß (Achtung: Wortspiel) und ein MACBOOK kaufte.
Tja, was soll ich sagen. Vor ziemlich genau sechs Jahren – also in 2010 – hatte ich ein Erlebnis der dritten Art mit meinem damaligen Notebook, bzw. dem Betriebssystem Windows Vista. Der Windows Explorer hatte sich irgendwie verabschiedet. Das heißt, es dauerte ewig (gefühlt eine viertel Stunde, gemessen 2-5 Minuten) bis nach einem Klick auf einen Ordner dann auch mal dessen Inhalt angezeigt oder die Ordnerstruktur entsprechend aufgeklappt wurde. Sämtliche im Internet verfügbaren Lösungsvorschläge (und das waren einige…) blieben erfolglos.
Am Ende blieb nur die Neuinstallation. Und natürlich hatte dem Rechner keine echte Betriebssystem-DVD beigelegen, sondern nur eine Recovery-DVD. Davon mal ab, dass man sich damit ja auch den ganzen Software-Ramsch wieder einhandelt, den so ein PC-Verkaufsladen ungefragt auf dem Rechner vorinstalliert, hatte diese Recovery-DVD (bzw. die zugehörige Treiber-DVD) einen kleinen Haken, auf den ich schon bei der damaligen ersten Fertiginstallation in 2008 herein gefallen war: Da kam nämlich an einer Stelle die Anweisung der Rechner neu zu starten, obwohl im Hintergrund noch fleißig gearbeitet wurde. Folgte man dieser Anweisung, war die Installation hinüber, und man konnte wieder von vorne anfangen. Schon mal ein halber Tag Arbeit in der Tonne…
Nungut. Es vergingen ungefähr zwei Tage, bis ich nach der zweiten Neuinstallation das Gerät wieder so eingerichtet hatte, wie es sein sollte. Also den ganzen Software-Schrott rausgeschmissen, stattdessen die benötigte Software installiert, Daten aus der Sicherung herüber kopiert, Email-Konten eingerichtet, und was es da sonst noch so alles zu tun gibt.
Dann startete ich die Datenträgerbereinigung, um die Festplatte von verbliebenen Installationsresten zu befreien. Die Festplatte wurde analysiert, und das Ergebnis der Analyse angezeigt. Da wunderte ich mich zwar, wieso die Datenträgerbereinigung auf einer Festplatte mit einer Gesamtkapazität von 160GB (nicht lachen; das war beim Rechnerkauf in 2008 durchaus OK) zwei Dateien mit jeweils mehr als 80GB in der Liste der “Kann-Weg-Dateien” anzeigte, schob das aber auf eine fehlerhafte Berechnung der Dateigröße (konnte ja nicht sein) und klickte auf “Mach mal”.
Fehler. SCHWERER Fehler. SAUBLÖDER, SEHR SCHWERER FEHLER.
Denn Windows fing an zu rödeln und auf einmal verschwanden Icons von meinem Desktop. Daraufhin habe ich die Datenträgerbereinigung zwar hektisch abgebrochen, aber es war schon zu spät…
Nachdem mein komplettes Repertoire an computerbezogenen Flüchen (ungehört) im Arbeitszimmer verhallt war, konnte ich die Neuinstallation des Rechners also schon wieder von vorne beginnen – zum dritten Mal.
Und DAS war dann der Moment, in dem ich mit geschworen habe, dass mein nächster Rechner ein MAC werden würde. Denn so eine Verschwendung von Lebenszeit würde mir nicht mehr wieder vorkommen. Und bei einem MAC sollte ja alles besser und schneller sein und vor allem reibungslos funktionieren.
Nur wenige Monate später habe ich diesen Schwur dann auch in die Tat umgesetzt. Knapp 2 Riesen habe ich abgedrückt und das leistungsstärkste 15er MacBook pro gekauft, dass Apple anzubieten hatte. Der Kaufpreis tat ein bißchen weh, aber das Gerät lief super. Neustart nach Software-Installation? Selten. Mit Ausnahme eines Office-Pakets und meiner Bildbearbeitungssoftware Lightroom und Photoshop war vollautomatisch alles an Bord (und alles funktionstüchtig). Und mit Garageband sogar ein sehr leistungsstarkes Musiktool gratis dabei. Der Gitarrist in mir freute sich ‘nen Keks. Und – für mich als Apple-Neukunde völlig überraschend – fix und fertig installiert. Dass man einen Computer kaufen, aufklappen und nach dem Anlegen des Benutzerkontos tatsächlich direkt damit arbeiten konnte, das kannte ich bis dahin nicht.
Ja gut, manche der Gratisbeigaben waren wenig für Customizing geeignet, iWeb zum Beispiel. Aber hey, immerhin war ein kostenloser Web-Editor einfach mal dabei, und sofern man von den Standards der eingebauten Themes nicht abwich, war alles easy.
Außerdem war das Teil natürlich einfach mal schick.
Gegenüber einem Windows-Rechner habe ich nur wenige Dinge vermisst. Am Anfang (das war dann das Betriebssystem Snow Leopard) gab es glaube ich im Kontextmenü keine Möglichkeit, die angeklickte Datei direkt in eine E-Mail zu packen. Oder dass ein Rechtsklick auf ein Programmicon im Tray nicht direkt die zuletzt mit dem Programm bearbeiteten Dateien anzeigte, fand ich auch nicht so toll. Aber sonst war nach ein bißchen Umgewöhnung alles gut. Vor allem dieses beruhigende Gefühl, mit der TimeMachine eine simple und unauffällig funktionierende Backup-Software laufen zu haben war schon richtig gut (und hat sich punktuell als sehr nützlich erwiesen).
Ich war durchaus für die nächsten paar Jahre im MAC-Himmel. Es schien tatsächlich “einfach nur zu funktionieren”. Bis zu dem Moment, von dem ich dann im nächsten Teil berichte…




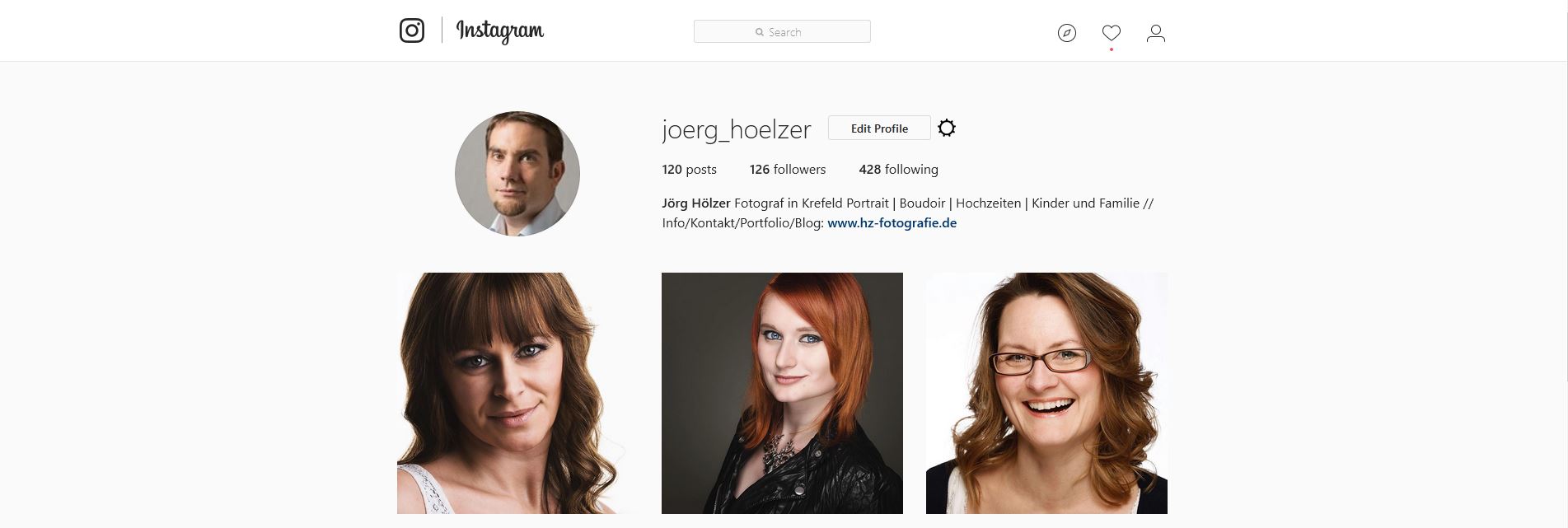




 2015 habe ich begonnen, mich in einem für mich ganz neuem Metier zu tummeln: dem Bereich der Boudoir-Fotografie. Um gleich „richtig“ (im Sinne von „möglichst produktiv“) einzusteigen, habe für mein erstes Shooting mit Christin auf ein sehr erfahrenes und nett unkompliziertes Model zurückgegriffen. Es war auch tatsächlich ein richtig guter Einstieg. Super nett, professionell und überaus ergebnisreich. Die Investition in das Modelhonorar hat sich meines Erachtens richtig gelohnt. Über den Unterschied zwischen der Atmosphäre des fertigen Foto und der Atmosphäre beim Erstellen der Fotos, der durchaus recht groß sein kann, habe ich in meinem Blogpost „
2015 habe ich begonnen, mich in einem für mich ganz neuem Metier zu tummeln: dem Bereich der Boudoir-Fotografie. Um gleich „richtig“ (im Sinne von „möglichst produktiv“) einzusteigen, habe für mein erstes Shooting mit Christin auf ein sehr erfahrenes und nett unkompliziertes Model zurückgegriffen. Es war auch tatsächlich ein richtig guter Einstieg. Super nett, professionell und überaus ergebnisreich. Die Investition in das Modelhonorar hat sich meines Erachtens richtig gelohnt. Über den Unterschied zwischen der Atmosphäre des fertigen Foto und der Atmosphäre beim Erstellen der Fotos, der durchaus recht groß sein kann, habe ich in meinem Blogpost „ 2015 gab es wieder eine Hochzeit zu fotografieren, nämlich die von Sandra und Markus.
2015 gab es wieder eine Hochzeit zu fotografieren, nämlich die von Sandra und Markus.
 Die Profilmontagen haben aber auch Gesellschaft bekommen: Nämlich von der sogenannten Türrahmencollage. DAS war mal so richtig was zum Dazulernen. Vor allem habe ich daraus gelernt, (für mich) neue Ideen erst dann in die Tat umzusetzen, wenn die örtlichen Verhältnisse dafür zumindest halbwegs optimal sind. Nun ja, es hat ja funktioniert und die fertige Collage hängt als hochwertiges und großformatiges Acrylbild im Haus der fotografierten Familie -ein Erfolg war es also auf alle Fälle. Auch dazu – das hast Du Dir sicherlich schon gedacht –
Die Profilmontagen haben aber auch Gesellschaft bekommen: Nämlich von der sogenannten Türrahmencollage. DAS war mal so richtig was zum Dazulernen. Vor allem habe ich daraus gelernt, (für mich) neue Ideen erst dann in die Tat umzusetzen, wenn die örtlichen Verhältnisse dafür zumindest halbwegs optimal sind. Nun ja, es hat ja funktioniert und die fertige Collage hängt als hochwertiges und großformatiges Acrylbild im Haus der fotografierten Familie -ein Erfolg war es also auf alle Fälle. Auch dazu – das hast Du Dir sicherlich schon gedacht –  In 2015 war es mir vergönnt, dann doch auch das eine oder andere Portrait-Shooting zu machen. Darunter fasse ich jetzt mal den bunten Strauß von Einzelportraits (und teilweise Kleingruppenaufnahmen), die ich entweder als Test-/TFP-Shootings mit Hobbymodellen, einem Shooting mit den Handwerkern eines Installateurbetriebs für die Firmen-Website und einer vierköpfigen Gruppe eines Coaching-Teams (ebenfalls für die Firmenwebsite) im Terminkalender stehen hatte.
In 2015 war es mir vergönnt, dann doch auch das eine oder andere Portrait-Shooting zu machen. Darunter fasse ich jetzt mal den bunten Strauß von Einzelportraits (und teilweise Kleingruppenaufnahmen), die ich entweder als Test-/TFP-Shootings mit Hobbymodellen, einem Shooting mit den Handwerkern eines Installateurbetriebs für die Firmen-Website und einer vierköpfigen Gruppe eines Coaching-Teams (ebenfalls für die Firmenwebsite) im Terminkalender stehen hatte. Schon 2014 haben wir (also meine Familie und ich) Urlaub an der Ostseeküste gemacht und zwar zufällig in Zingst, und weiterhin gaaaanz zufällig zur Zeit des dortigen großen Fotofestivals. Und weil das so schön war, haben wir das in diesem Jahr gleich nochmal gemacht. Und es war wiederum prachtvoll. Ein schöner Familienurlaub – ein Foto davon steht ganz oben über diesem Blogpost – mit reichlich eingestreuten Ausstellungsbesuchen, abendlichem Spirit-of-Zingst-Schnuppern und natürlich dem Besuch eines Workshops. Wieder (wie schon in 2014) bei
Schon 2014 haben wir (also meine Familie und ich) Urlaub an der Ostseeküste gemacht und zwar zufällig in Zingst, und weiterhin gaaaanz zufällig zur Zeit des dortigen großen Fotofestivals. Und weil das so schön war, haben wir das in diesem Jahr gleich nochmal gemacht. Und es war wiederum prachtvoll. Ein schöner Familienurlaub – ein Foto davon steht ganz oben über diesem Blogpost – mit reichlich eingestreuten Ausstellungsbesuchen, abendlichem Spirit-of-Zingst-Schnuppern und natürlich dem Besuch eines Workshops. Wieder (wie schon in 2014) bei 



